Terminvergabe für Darmspiegelung: werktäglich von 9-12 Uhr unter
PKV-Terminvergabe: werktäglich unter
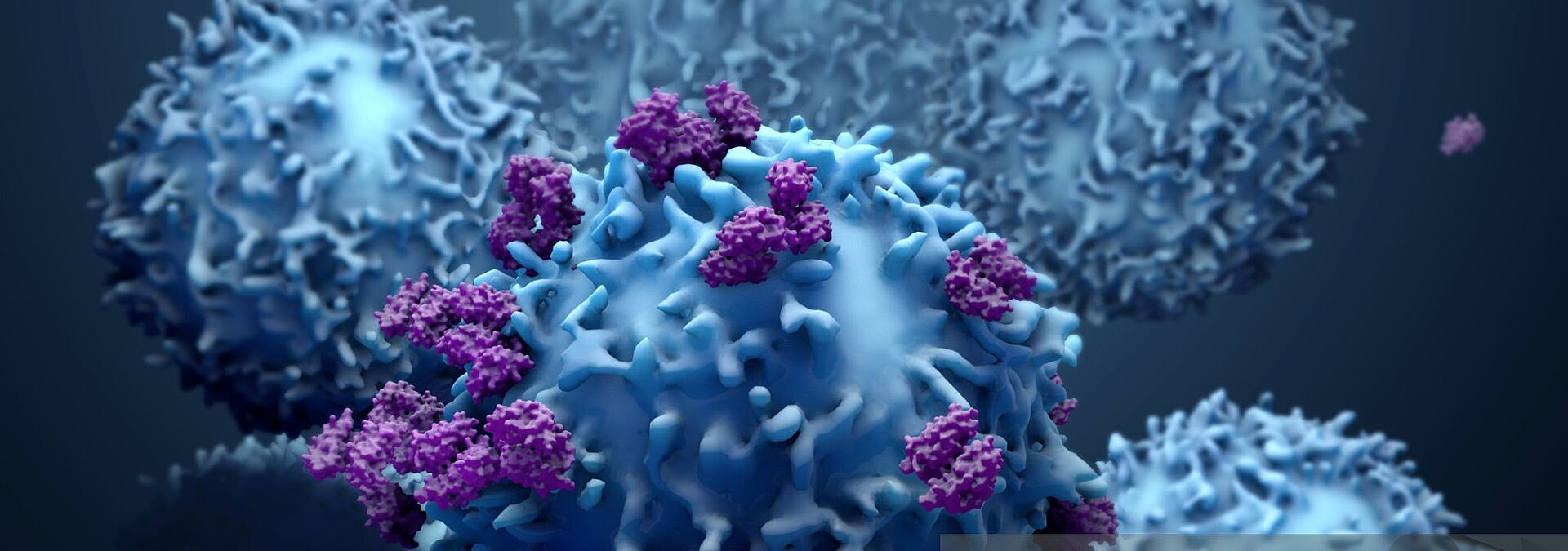
Unser Viszeralonkologisches Zentrum besteht aus einer Kooperation von über 25 Behandlungspartnern – neben Kliniken und Einrichtungen des Katholischen Krankenhauses auch niedergelassene Ärztinnen, Ärzte, Reha-Kliniken sowie unter anderem zwei Selbsthilfegruppen, die seit vielen Jahren eng zusammenarbeiten.
2007 war unser Darmzentrum die erste Einrichtung ihrer Art, die im Freistaat Thüringen von der Deutschen Krebsgesellschaft qualitätszertifiziert wurde. Seit 2019 ist es, erweitert um den Schwerpunkt Pankreaskrebs, als Viszeralonkologisches Zentrum zertifiziert.

Warum sollten Sie sich in einem zertifizierten Zentrum behandeln lassen?
Die enge Zusammenarbeit von Experten des Katholischen Krankenhauses und externer Kooperationspartner aus verschiedenen Fachrichtungen bedeutet für Sie rasche Informationsflüsse zwischen den beteiligten Ärzten, eine bestmögliche und umfassende Diagnostik und Behandlung. Zudem findet einmal wöchentlich ein sogenanntes fachübergreifendes Tumorkonsil statt, bei dem Krankheitsfälle Zentrums besprochen werden.
Rufen Sie uns gern an und wir kümmern uns darum, dass Sie schnellstmöglich einen Termin erhalten. In einem ersten Gespräch wird dann geklärt, wie das weitere Vorgehen ist bzw. was für Termine im Anschluss vereinbart werden sollten. Der Kontakt zum Viszeralonkologischen Zentrum des Katholischen Krankenhauses ist über das Sekretariat der Klinik für Allgemein-, Visceral-, Thorax- und Gefäßchirurgie (Telefon: 0361 654-1201) bzw. über die Ambulanz der Klinik für Innere Medizin I / Gastroenterologie (Telefon: 0361 654-1184) herzustellen.
Von diesem Moment an sind Sie in die Behandlungsstrukturen des Zentrums eingebunden und genießen eine individuell auf Sie abgestimmte weiterführende Diagnostik, Therapie und Nachsorge durch die verschiedenen Partner.
Nein. Es bedeutet nicht zwangsläufig, dass man selbst an Darmkrebs erkrankt. Das Risiko ist allerdings höher, sodass eine Vorsorgeuntersuchung (Darmspiegelung) bereits mit 40 oder 45 Jahren empfehlenswert ist und bei genetischer Vorbelastung auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Wenn in Ihrer Familie Formen des erblichen Darmkrebses, zum Beispiel HNPCC, vorgekommen sind, sollte ab dem 25. Lebensjahr einmal jährlich eine Vorsorgeuntersuchung durchgeführt werden. Bei der Familiären Adenomatösen Polyposis (FAP) fangen die Vorsorgeuntersuchungen bereits im Jugendalter an.
Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unregelmäßigkeiten (Farbe, Form, Häufigkeit) beim Stuhlgang beobachten, Blut im Stuhl oder anhaltende bzw. wiederkehrende Beschwerden im Magen-Darm-Trakt haben, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Der zuständige Facharzt ist der Gastroenterologe. Er wird gemeinsam mit Ihnen besprechen, welche Untersuchungen erforderlich sind.
Die Erstattung der Darmkrebsvorsorge erfolgt seit dem Jahr 2002. Der Stuhlbluttest wird ab 50 Jahren, die präventive Koloskopie wird ab dem 55. Lebensjahr kostenlos angeboten, sofern keine Risiken, z.B. chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder Darmkrebs bei nahen Verwandten, vorliegen (in diesem Fall erfolgt die Erstattung altersunabhängig).
Wenn Sie Beschwerden haben (siehe vorherige Frage), sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen und dieser wird gemeinsam mit Ihnen entscheiden, ob eine Darmspiegelung durchgeführt werden sollte. Gesetzlich Versicherte wenden sich hierzu am besten an ihren Hausarzt bzw. einen niedergelassenen Gastroenterologen, der im Rahmen einer Behandlungsmaßnahme auch in ein Krankenhaus einweisen kann. Privatpatienten können sich direkt an ein Krankenhaus wenden.
Wenn Sie einen Termin zur Koloskopie vereinbaren möchten, rufen Sie uns gern an: Klinik für Innere Medizin I / Gastroenterologie - gastroenterologische Funktionsabteilung: 0361 654-1184, bei gewünschter privatärztlicher Untersuchung o. Behandlung: 0361 654-1101.
Die Darmspiegelung kann mit einer Sedierung durchgeführt werden. Das heißt, Sie können die Untersuchung “verschlafen” und haben dabei keine Schmerzen.
Sie können selbst entscheiden, ob die Darmspiegelung mit oder ohne eine leichte Sedierung durchgeführt wird. Eine Vollnarkose ist in der Regel nicht erforderlich.
Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Untersuchungen.
Die größte Chance auf Heilung besteht, wenn der Tumor und das umliegende betroffene Gewebe vollständig chirurgisch entfernt werden. Davon abgesehen, können auch eine Chemotherapie und/oder eine Strahlentherapie vor oder nach der Operation notwendig werden. Bei sehr frühen Befunden, die in den oberen beiden Schichten der Darmwandung liegen, kann schon die vollständige endoskopische Entfernung des Befundes zur Heilung führen. Das Risiko eines Rezidivs (Rückfalls) kann Ihnen dann der Gastroenterologe in Kenntnis des histologischen Befundes (Beurteilung durch den Pathologen) erläutern.
Darmkrebs ist zwar eine der häufigsten Krebsformen, kann aber sehr gut behandelt bzw. geheilt werden. Entscheidend hierbei ist das Stadium, in dem der Krebs festgestellt wird - je eher, desto besser.
Die Entstehung von Darmkrebs ist nicht vollends geklärt, sodass eine Vorbeugung nicht zu 100 Prozent möglich ist. Eine gesunde und ballaststoffreiche Ernährung, die gesteigerte Zufuhr von Obst und Gemüse sowie ausreichend Bewegung wirken sich jedoch sehr positiv aus. Als Risikofaktoren wurden der tägliche Genuss von rotem Fleisch (unter anderem Rind, Schwein, Lamm) und Übergewicht identifiziert. Regelmäßiger Alkoholkonsum ist unabhängig von der Art des Getränkes ebenfalls problematisch. Auf das Rauchen zu verzichten, kann einen von acht Dickdarmkrebsen verhindern. Laut Studien ist bekannt, dass bei Rauchern der Dickdarmkrebs im Schnitt acht Jahre eher auftritt als bei Nichtrauchern. Außerdem ist eine Darmspiegelung als Vorsorgeuntersuchung empfehlenswert, insbesondere wenn Sie familiär bedingt ein erhöhtes Risiko haben, an Darmkrebs zu erkranken.
Der Bauspeicheldrüsenkrebs ist ein bösartiger Tumor, der in den meisten Fällen vom Gangsystem des Bauspeicheldrüsenkopfes ausgeht. Mit Fortschreiten der Erkrankung kommt es häufig zu einem Aufstau von Gallenflüssigkeit und Bauchspeicheldrüsensekret. Zusätzlich kann sich der Tumor in Lymphknoten, Nerven und Blutgefäße ausbreiten oder Tochtergeschwülste in der Leber bilden. Sollte es zu einer Metastasenbildung gekommen sein, dann ist eine Entfernung des Tumors häufig nicht mehr erfolgversprechend. Das Wachstum des Karzinoms ist jedoch von vielen verschiedenen Faktoren abhängig.
Tumore der Bauchspeicheldrüse verursachen in der Regel erst sehr spät Beschwerden. Häufig sind eine Verminderung der Leistungsfähigkeit, Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit zu beobachten. Sollte der Tumor zu einem Aufstau der Gallenflüssigkeit führen, kommt es zu einer Gelbsucht. Charakteristisch hierfür sind dunkler Urin, heller und fettglänzender Stuhl, eine gelbe Bindehaut und Hautjucken. In jedem Fall sollten Sie diese Symptome rasch abklären lassen.
Man nimmt an, dass nur etwa 10 Prozent der Pankreaskarzinome vererbt werden. Das heißt im Umkehrschluss, dass bei 90 % der Pankreaskarzinome keine erbliche Komponente besteht.
Ob und wie der Tumor im Einzelfall behandelt wird, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Wichtige Fragen sind: Wie groß ist der Tumor? Wo genau sitzt er? Hat sich der Tumor bereits lokal ausgebreitet? Gibt es Tochtergeschwülste (Metastasen)? Eine umfängliche und individuelle Beratung durch Ihre Ärztin/Ihren Arzt steht in jedem Fall an erster Stelle Ihrer möglichen Behandlung.
Eine Chemo- und / oder Strahlentherapie kann die Heilungschancen erhöhen. Wir werden immer mit Ihnen gemeinsam Ihre individuelle Behandlung besprechen.
Da der Bauchspeicheldrüsenkrebs ein sehr aggressiver Tumor ist, tritt dieser relativ häufig nach kompletter Tumorentfernung wieder auf. Zudem bilden sich sehr oft Metastasen in Leber, Lunge oder Bauchfell. Trotzdem ist die Operation derzeit die einzige Möglichkeit, eine Heilung zu erzielen.
Wenn, aufgrund von Metastasenbildung oder eines bereits fortgeschrittenen Tumors, eine operative Entfernung nicht möglich ist, besteht häufig die Möglichkeit einer Chemotherapie, die das Wachstum des Tumors zumindest verlangsamen kann. Auch hierbei stehen Ihnen unsere Expertinnen und Experten aus allen medizinischen Bereichen und in allen zwischenmenschlichen Fragen beratend und unterstützend zur Seite.
Viszeralonkologisches Zentrum
Haarbergstraße 72 | 99097 Erfurt
Tel. 0361 654-1201
E-Mail. vz@kkh-erfurt.de